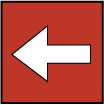Wie entsteht eine Ausstellung?
von Sara
Bangert
Wenn
der Besucher gedankenverloren durch eine Ausstellung oder ein
Museum wandelt, sich von den Wirkungen der Objekt faszinieren
lässt und dabei
die Zeit vergisst – dann haben andere ihre Arbeit
längst getan. Fünf Profis
erzählen aus ihrer jeweiligen Perspektive, wie aus einer Idee
eine Ausstellung
wird.
1. Die Planerin

Anja Dauschek, Leiterin des
Planungsstabs für das
künftige
Stuttgarter Stadtmuseum
„Am Anfang steht
die
Idee“, sagt
Anja Dauschek, Leiterin des Planungsstabs für das
künftige Stuttgarter Stadtmuseum,
das 2012 eröffnet werden soll. Eine große
Verantwortung, da die gesamte Konzeption
und Umsetzung des neuen Museums in ihrer Hand liegen. Momentan steckt
die in
der Ausstellungsplanung erfahrene
„Kulturvermittelnde“ noch mitten in den
verschiedenen
Vorbereitungen: Sie kommuniziert mit anderen Museen. Sie sucht nach
Geldgebern.
Sie beschäftigt sich mit Depotplanung. Und sie stellt Ideen
und Konzeptionen im
Gemeinderat vor, der als Vertreter der Stadtbevölkerung alle
ihre Vorhaben
absegnen muss.
Dauschek
erklärt den Prozess
der Ausstellungsplanung
so: „Wenn die gewünschte Aussage feststeht, macht
man sich über deren
Kommunikation Gedanken und entwickelt Inhalte.“
Dabei ist das
spezielle Format
Ausstellung zu berücksichtigen: „Eignet es sich
besser als beispielsweise eine
Publikation, um zu vermitteln, worum es geht? Wie präsentiere
ich Objekte
stehenden und umherlaufenden Besuchern? Geht es darum, einen
kommunikativen
Raum zu schaffen, in dem Menschen miteinander ins Gespräch
kommen sollen?“
Gleichzeitig werden Umsetzungsfragen ins Auge gefasst: Sollen die
Objekte schlicht
präsentiert oder sollen sie aufwendig inszeniert werden?
Eignet sich zur
Vermittlung ein interaktives Spiel? Stadtmuseen
haben Tradition. Zum
üblichen Konzept eines Stadtmuseum gehören Chronik,
Dauerausstellung und ein
Bereich für Sonderausstellungen. Doch Anja Dauschek hat Ideen,
die darüber weit
hinausreichen. Darunter der „Idea store“, ein
offenes Kulturforum in
Zusammenarbeit mit Bibliotheken, in dem den Nutzern Informationen und
Raum zur
Verfügung gestellt werden. Der Idee des Web 2.0 folgend,
bringen diese die
Inhalte selbst mit.
In engem Kontakt mit ihrer
breiten
Zielgruppe entwickelt Dauschek anspruchsvolle Konzeptionen, wie die
Themen
„Stadt“ und „Stadtgeschichte“
aus verschiedenen Perspektiven – zum Beispiel
auch der eines Migranten – angemessen repräsentiert
werden können. Urbanität
und städtisches Zusammenleben in Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft sollen
von den Stuttgartern aus verschiedenen Blickwinkeln diskutiert und auf
dieser
Basis umgesetzt werden.
Doch die Pläne gehen noch
weiter:
„Das Stadtmuseum soll auch ein Ort für Kinder und
Jugendliche sein.“ In einem
sicheren, inhaltlich geschützten und unzensierten Raum werden
ihnen technische
Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, um
beispielsweise eigene Ideen zu
Stadtplanung und Architektur zu entwickeln. Große Pläne, doch
Anja Dauschek,
die auch gerne tatkräftig mit anpackt, lässt sich
nicht entmutigen: „Ich fange
lieber im Großen an, dann kann man ja immer noch kleiner
werden.“
2. Der Ingenieur

Kopf Hüttinger
Im modernen
Firmengebäude der
„Hüttinger
Exhibition Engineering“ bei Nürnberg dampfen und
rotieren Maschinen. Es sind Prototypen
für künftige Ausstellungen: Die Apparate sollen
mathematische Berechnungen und
physikalische Phänomene anschaulich machen. Der studierte
Ingenieur Axel
Hüttinger entwirft Konzepte für industrielle und
technische
Wissenschaftsausstellungen, aber auch für so genannte Science
Centers, die
derzeit einen Boom erleben. Science Centers sind Institutionen, die in
multimedialen und interaktiven Erfahrungsräumen
Wahrnehmungsphänomene,
kulturelle Entwicklungen oder naturwissenschaftliche Erkenntnisse
erlebbar
machen.
Die Firma Hüttinger
plant
nicht
nur, sondern setzt die Konzepte auch selbst um. Damit ist sie der
einzige
deutsche Komplettanbieter auf einem kleinen Markt mit hoher
internationaler
Konkurrenz. „In den USA, in England und Skandinavien wird
naturwissenschaftliche Bildung viel stärker
gefördert“, sagt Hüttinger. Kinder
würden durch informelles Lernen früh an
naturwissenschaftliche Inhalte herangeführt,
so werde auf lange Sicht der wissenschaftliche Nachwuchs
gefördert – eine
Investition, die nach Hüttingers Meinung auch Deutschland
künftig leisten muss.
Jährlich werden weltweit zehn
bis
zwanzig Science-Center-Projekte ausgeschrieben, aktuell beispielsweise
„Roots
of Civilisations“ in Warschau.
Die Auftragsvergabe ist ein
mehrstufiger Prozess: In der Präqualifizierungsphase
wählt der Kunde aus 30 bis
40 konkurrierenden Bietern etwa fünf aus; Kompetenz,
technische Möglichkeiten,
Erfahrung, Referenzen und Solidität sind seine Kriterien. Die
Auserwählten
arbeiten für eine begrenzte Geldsumme ein Angebots aus. Der Kunde kann die in den Meetings
vorgestellten
Angebotsentwürfe modifizieren. Der Prozess bis zum
Vertragsschluss dauert bis
zu einem halben Jahr – für die Firmen ein
kräftezehrendes und intellektuell forderndes
Verfahren. Die flexible Projektentwicklung im Dialog bietet aber auch
ihnen
höhere Chancen, einen Auftrag zu erhalten.
Nach britischem Vorbild
werden
„Design
and Build“-Verträge abgeschlossen: Eine Firma
entwirft das Konzept, konstruiert
Prototypen und baut die Ausstellung auf. Das vermeidet Brüche
in der Gestaltung
und macht das gesamte Verfahren effizienter und preiswerter. Nach dem
„Kick-off-Meeting“
beginnt in der Firma Hüttinger die Produktionsphase. Vier
erfahrene Gestalter
sind für Entwürfe zuständig, acht
Konstrukteure setzen diese um. In den hausinternen
Büros und Werkstätten – darunter Planungs-
und Konstruktionsbüros, Schreinerei,
Schlosserei, Elektrotechnikwerkstatt, Lackiererei – werden
Prototypen entworfen
und auf ihrem Weg durch das Firmengebäude Stück
für Stück fertig gebaut.
Hüttinger lässt Kinder die Prototypen schon in der
Produktionsphase testen, um
sie ergonomisch zu optimieren.
„Wie funktioniert
Lernen?“ Das ist
die Frage, die den Ingenieur durch alle Phasen leitet, denn in einer
Ausstellung kann nicht sequenziell Wissen vermittelt werden.
„Sie funktioniert
chaotisch“, da wegen der kurzer Besuchszeiten nur Anregungen
gegeben werden
können: das interaktive „Be-greifen“ von
Inhalten kann Erfolgserlebnisse auslösen,
motivieren und Erkenntnisprozesse anregen.
3. Die Kuratorin

Kuratorin Anke te Heesen
„auf/zu. Der
Schrank in den
Wissenschaften“ – schon der Titel war originell,
zog viele Besucher an und
erregte internationale Aufmerksamkeit. Die positive Resonanz auf diese
Ausstellung war ein geglückter Start für
das
entstehende Universitätsmuseum Tübingen. Es soll in
Zukunft weitere für die
Kultur- und Wissenschaftsgeschichte oder die naturwissenschaftliche
Forschung
aktuelle Themen aufgreifen und sie mit einem weiten Horizont und
interdisziplinärem Anspruch präsentieren.
Der Kuratorin Anke te Heesen
geht
es darum, Themen aufzuarbeiten, die zwischen Universität und
Öffentlichkeit, unter
Laien und Experten diskutiert werden –
„Schnittstellenthemen“ nennt sie sie.
Zugleich möchte sie eine „Wissenschafts-, Kultur-
und Sozialgeschichte der
Universität“ vermitteln und mit deren Hilfe
kulturelles Bewusstsein schaffen. Laien
sollen verstehen, wie eine Universität oder ein akademischer
Diskurs funktioniert,
Experten sollen Anregungen für die Forschung gewinnen.
Anke te Heesen sieht die
Entstehung
einer Ausstellung als „professionellen kreativen
Prozess“ zwischen „offenem
Laufenlassen“ und „forciertem, konzentrierten
Arbeiten“, der am besten in ständigem
Dialog und intensiver Auseinandersetzung mit Künstlern, Raum
und Objekten
gelingt. Der dauernde Kontakt sei wichtig, um den Keim der Idee, die
erste
Innovation, im Laufe des Prozesses zu bewahren, anstatt durch
Inszenierungen
eine Illustration von Vorgedachtem zu präsentieren.
Bei der Auswahl der
Ausstellungsstücke
greift das Universitätsmuseum vorwiegend auf die zahlreichen,
noch immer nicht
komplett inventarisierten Sammlungen der Universität
zurück. Diese sind in Tübingen
nicht in einem Depot zusammengefasst, sondern dienen den Instituten
teils als
Schausammlung oder „Sehschule“ und müssen
daher für jede Ausstellung einzeln
transportiert werden.
Eine besondere
Herausforderung, die
Ausstellungsmacherinnen nach Anke te Heesens Erfahrung immer wieder
durchleben,
ist der arbeitsintensive Zeitpunkt zwei bis sechs Monate vor der
Eröffnung: Vieles
muss gleichzeitig geleistet werden und die Erfüllung des
Konzepts scheint
zuweilen aussichtslos. Pressearbeit, Leihverkehr, mitunter heikle
Transportorganisation,
Versicherung, Objektstatus, Publikation, Öffentlichkeitsarbeit
und Schriftverkehr
müssen erledigt werden.
Doch dann kommt der
„großartige
Moment“, der für te Heesen die Faszination des
Ausstellungsmachens darstellt
und sie für alle Schwierigkeiten entschädigt: Auf dem
Bildschirm entworfene
Ansichten und durch das Vorstellungsvermögen konstruierte
Raumwirkungen werden
in einem spannungsvollen Augenblick Wirklichkeit. Die Objekte werden
angeliefert und verteilt oder gehängt und entfalten ihre
Wirkung und Wechselwirkung
im Raum. Euphorie oder Frustration können entstehen, je
nachdem, ob das Konzept
aufgegangen ist oder nicht. Oft muss bis spät in die Nacht
nachgebessert
werden, bis sich neue, möglicherweise interessantere Wirkungen
ergeben –
ästhetisches Empfinden, ein geschultes Auge und Erfahrung
spielen hier eine
große Rolle.
„Ich habe die Arbeit mit
Objekten immer
als Forschung betrachtet“, sagt Anke te Heesen. Ihrer Meinung
nach wird die Ausstellung
der Zukunft auch der Wissenschaft dienen – als methodische
Plattform, produktive
Forschungsbasis und Publikationsform. Nach ihrer Berufung an das
Tübinger Ludwig-Uhland-Institut
für empirische Kulturwissenschaften wird sie ihr theoretisches
und praktisches
Wissen an Studenten weitergeben und will dafür mit dem
Unimuseum eng
zusammenarbeiten. Ihre Nachfolgerin oder ihr Nachfolger können
auf ihrer
richtungweisenden Arbeit aufbauen.
4. Die
Gestalterin

Die Kreative: Helen Hofmann
Helen Hofmann arbeitete bis
September 2007 in einer Agentur für Umweltkommunikation in
Göttingen.
Fachkräfte im Bereich Biologie, Landschaftsplanung und
Geologie konzipierten Ausstellungen
zu Natur- und Umweltschutz, die sich an Kinder, Familien und Senioren
richteten. Im ersten Brainstorming wurden Projektvorstellungen der
Kunden,
häufig Nationalparks am Wattenmeer, vorgestellt und Ideen
gesammelt.
Unter den
wissenschaftlich
geschulten Kollegen war Hofmann die einzige
„Kreative“ – und hatte entsprechend
viele Freiheiten. In der ersten Planungsphase brachte die studierte
Kommunikationsdesignerin
Ideen zu Ästhetik und Raumdesign ein. In einer zweiten
Konzeptionsphase wurden
die Ideen aussortiert – nach Kundenwünschen und
Umsetzbarkeit in technischer
und finanzieller Hinsicht. „Die Finanzierung ist besonders im
Umwelt-Bereich
ein schwieriges Thema“, weiß Hofmann. Das
Grobkonzept wurde dem Kunden in einer
Präsentation vorgestellt und nach dessen Rückmeldung
überarbeitet, aufwendig
ausgeführt und nochmals präsentiert.
Dann begann die Umsetzung des
Ausstellungskonzepts. Helen Hofmann reichte Gestaltungskonzepte ein,
die Farben,
Schriften, Gestaltungsregeln, den Gebrauch von Fotos, Bildern, Text
oder
Illustrationen und damit eine einheitliche und kohärente
Gestaltung festlegten,
und setzte sie entsprechend um. Mithilfe spezieller Computerprogramme
gestaltete
sie Illustrationen und großformatige Informationstafeln,
Panoramawände und
Sticker und verbesserte die Qualität niedrig
aufgelöster Fotos, Logos und
Karten. „Dazu gehört die technische Erfahrung, um
zum Beispiel Bildgrößen
einschätzen zu können“, sagt sie. Trotz
mancher Probleme beim Druck war die
kreative und eigenverantwortliche Arbeit erfüllend:
„Die ersten fertigen
Druckerzeugnisse sind wie ein Baby: Es wird von vielen Menschen
betrachtet
werden, die sich durch ein schönes Design vielleicht ermuntert
fühlen, die
Ausstellung zu besuchen und die Information aufzunehmen. Das ist
Kommunikationsdesign!“
Auch durch neue Medien und
interaktive Elemente wurden Themen ansprechend und unkonventionell
umgesetzt,
um zum Beispiel Informationen zum sensiblen Lebensraum Watt mit allen
Sinnen
erfahrbar zu machen und Wissen durch eigenes Begreifen präsent
zu halten. „Gerade
in diesem Themenbereich hat man mit verstaubten, selbstgezimmerten
Öko-Vorurteilen zu kämpfen.“ Helen Hofmann
sieht Ausstellungen als
wirkungsvolle Möglichkeit, dies zu ändern und Themen
wie dem Umweltschutz ein
neues Image zu geben. Nach ihrem Umzug nach Süddeutschland
sucht sie nun nach
einer neuen kleinen Agentur, die im kulturellen Bereich tätig
ist.
5. Der Techniker

Tobias Fleck, Koordinator, Ansprechpartner
und Moderator
Tobias Fleck ist seit drei
Jahren
Leiter der Abteilung für Ausstellungstechnik im Kunstmuseum
Stuttgart. Als Koordinator,
Ansprechpartner und Moderator zwischen unterschiedlichen Interessen
behält er den
Überblick über den Prozess des Ausstellungsaufbaus.
Die hohen technischen
Standards des Kunstmuseums werden immer wieder gelobt – eine
wichtige Basis für
Leihverkehr und Beziehungen zu anderen Museen.
Spätestens sechs
Monate vor
Eröffnung der Ausstellung informiert der Kurator
Restauratoren, Öffentlichkeitsarbeiter,
Logistiker und Techniker über das Grobkonzept. Ideen zur
Ausstellungsarchitektur werden nun zu einem umfassenden Raumkonzept
ausgearbeitet,
das Zwischenwände, Vitrinen, Sockel und Wandfarben umfasst und
schließlich von
einem Ausstellungsarchitekten skizzenhaft zu Papier gebracht wird.
Objekt-,
Bilder- und Projektionsgrößen müssen ebenso
berücksichtigt werden wie der
Präsentationsrahmen. Fleck
– mit den
Gegebenheiten vor
Ort bestens vertraut – begleitet den Konzeptionsprozess und
bringt eigene Ideen
zur Ausstellungsarchitektur ein.
Dann werden Anfragen an Handwerker
geschickt und Aufgaben an Firmen – Schreiner, Maler und
Schlosser – delegiert. Als
Richtlinie fungiert ein raumbezogener Plan. Umbauphasen zwischen den
Ausstellungen dauern ungefähr vier Wochen. Eine sehr
arbeitsreiche Phase, während
der in täglichen Teambesprechungen Prozesse abgestimmt und
koordiniert werden. Wände
müssen überstrichen, alte Haken entfernt und neue
angebracht, Zwischenwände
abgebaut und neue eingezogen werden. Spätestens zwei Tage vor
Anlieferung der Kunstwerke
müssen die Malerarbeiten abgeschlossen sein, damit das feuchte
Raumklima den
Bildern und Objekten nicht schadet. Die Leihgaben –
beispielsweise aus dem
Metropolitan Museum of Art oder dem MOMA aus New York –
bleiben zur
„Akklimatisierung“ einen Tag lang in Klimakisten,
bevor sie von Restauratoren
auf Transportschäden kontrolliert werden. Der Kurator
dirigiert Verteilung und
Hängung, und unter Flecks Kommando wird im Team gebohrt,
gemessen, justiert und
umgehängt, bis der ästhetische Eindruck stimmt.
Doch nicht nur Kunstwerke und
ihre
Beschilderung sind Teil der Ausstellung, auch Informationskarten oder
Kataloge
gehören dazu: Tische, Ablagen und Halterungen für
Kataloge werden ästhetisch
abgestimmt, positioniert und montiert. Zuletzt geht es an die
elektronische
oder mechanische Sicherung. Besonders sensible Werke müssen
zusätzlich
abgesperrt werden. Spezialisten kontrollieren die computergesteuerte
Feinabstimmung
der Beleuchtung: Ein dreidimensionales Objekt braucht eine andere
Beleuchtung
als ein Gemälde oder eine Fotografie. Eigene Anforderungen an
Licht- und
Soundtechnik stellen Projektionen: Beamer und DVD-Player
müssen positioniert
und Wände schwarz gestrichen werden, Teppiche,
Vorhänge und Schalldämmungen sorgen
für den richtigen Klang.
Manchmal komme er sich vor wie ein
„Hütehund“,
der immer weiß, wer wann wo ist und wo sich welches Material
gerade befindet,
sagt Tobias Fleck. Deswegen hat er auch besonderen Spaß
daran, ab und an selbst
anzupacken. Dazu hat er spätestens wieder Gelegenheit, wenn es
zuletzt an den „Feinschliff“
geht: Zwei Tage lang läuft Fleck mit Pinselchen durch die
Räume, beseitigt
Arbeitsspuren, stopft Löcher und berücksichtigt
letzte Änderungswünsche des
Kurators – bis der Eröffnung der Ausstellung nichts
mehr im Wege steht.
Der magische
Moment
Planerin, Ingenieur, Kuratorin,
Gestalterin und Techniker beschäftigen sich auf sehr
unterschiedliche Weise
täglich mit Fragestellungen der Ausstellungsentstehung. Durch
den Einblick in ihre
Arbeit werden Planungs- und Umsetzungsprozesse nachvollziehbar. Die
Beantwortung
der Frage, wie eine Ausstellung entsteht, führt aber weder zu
allgemeingültigen
Antworten noch zu einem eindeutigen „Rezept“.
Vielmehr hängt sie eng mit einer weiteren
Frage zusammen: Was sind die Ziele einer Ausstellung und was kann sie
leisten? Je
nach Zielsetzung variieren Herangehensweisen, Problemstellungen und
Lösungen.
Sie verschmelzen zu einer individuellen „Kunst der
Vermittlung“.
Gemeinsam ist den aktiv Beteiligten
die Freude am Ausstellungsmachen: Es ist eine Beschäftigung,
die Kopf und Hände
gleichermaßen fordert. Auch die Faszination wird deutlich,
die Vermittlungsprozesse
auslösen können: Gedanken, Ideen, Konzepte treten in
die Wirklichkeit und
beginnen, ihre Wirkung zu entfalten. „Diese Arbeit im Raum,
wenn Ihre Thesen
dreidimensional werden, das ist das Allerschönste, es gibt
nichts Schöneres“, benennt
es Anke te Heesen. Die fünf Perspektiven lehren vor allem
eins: Eine
Ausstellung entsteht durch Erfahrung und Wissen, intensive
Auseinandersetzung,
harte Arbeit, unablässiges und selbstloses Engagement
– und durch Begeisterung.