Wo bleibt das Brennstoffzellenauto?
von Celia Eisele
Energieeffizienz, CO2-Grenzen, Spritsparen: Die Europäische Kommission hat das Auto als Mitverursacher des Klimawandels wiederentdeckt. Autos müssen effizienter werden, so der Wille der Umweltpolitiker. Auch alternative Kraftstoffe wie Biodiesel, Ethanol und Erdgas sind in aller Munde. Um eine weitere Alternative jedoch ist es stiller geworden in den letzten Jahren: die Brennstoffzelle.

Brennstoffzellenbus in Stuttgart.
Foto: Archiv Stuttgarter Straßenbahnen
Einst wurde sie euphorisch gefeiert, als nahende
Lösung des Erdölproblems gepriesen, herrscht heute in
der öffentlichkeit häufig Ratlosigkeit: Wo ist sie
geblieben, die Retterin von Klima und Autofahrern
gleichermaßen? Wann kommt das Brennstoffzellenauto? Und:
Kommt es überhaupt, oder gehört es in doch in das
Reich der Utopien?
Für Detlef Stolten, Leiter des Instituts für
Energieforschung am Forschungszentrum Jülich, ist klar: Die
Entscheidung für das Brennstoffzellenauto ist gefallen. Denn
auch beim Auto gilt: „Wir müssen mit dem
Kohlenstoffdioxid runter, und da ist die Brennstoffzelle eine echte
Chance.“
Politik, Wissenschaft und Wirtschaft sind sich in diesem Punkt einig:
Effizienzsteigerung ist wünschenswert, doch alleine wird sie
nicht ausreichen, um das Klimaproblem in den Griff zu bekommen.
Stattdessen muss es möglich werden, auf lange Sicht ganz auf
erdölbasierte Treibstoffe zu verzichten. Motoren, die von
Brennstoffzellen angetrieben werden, verursachen keine
schädlichen Emissionen, aus dem Auspuff kommt nur harmloser
Wasserdampf.
Unbegrenzt verfügbar
Denn Brennstoffzellen nutzen Wasserstoff als
Energielieferant. Dieser ist im Gegensatz zum Erdöl in nahezu
unbegrenzter Menge überall auf der Welt verfügbar.
Die fossilen Energiequellen gehen zur Neige – je nach
Szenario mal in naher, mal in fernerer Zukunft. Doch ganz gleich nach
welcher Schätzung, auf Dauer werden wir nicht auf sie bauen
können. Da scheint es naheliegend, den Fokus auf Wasserstoff
zu richten, eines der häufigsten Elemente auf der Erde und das
häufigste Element überhaupt im Universum.
Wie funktioniert eine Brennstoffzelle?
In der Brennstoffzelle findet die Umkehrung der Elektrolyse statt, bei
der Wasser unter Zuführung von Energie in Wasserstoff und
Sauerstoff getrennt wird. Die Brennstoffzelle wandelt also die beiden
Gase Wasserstoff und Sauerstoff in Wasser um und erzeugt aus der dabei
frei werdenden Energie elektrischen Strom.
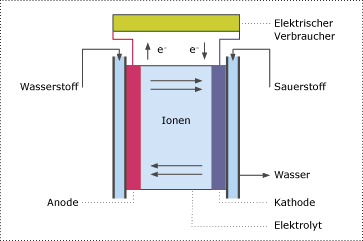
Schematischer Aufbau und Funktion einer Brennstoffzelle.
Quelle:Solaratlas Hochschule für Technik, Wirtschaft und
Kultur Leipzig
Aufgebaut ist die Brennstoffzelle aus drei Teilen: einer negativ
geladenen Schicht (Anode), einer positiv geladenen Schicht (Kathode)
und einem dazwischen liegenden Elektrolyten, häufig in Form
einer Membran. Anode und Kathode sind über einen elektrischen
Leiter miteinander verbunden. Der Wasserstoff wird an der Anode in die
Brennstoffzelle eingeleitet und spaltet sich dort in positiv geladene
Wasserstoff-Ionen (H+) und negativ geladene Elektronen auf. Parallel
dazu wird an der Kathode Sauerstoff eingeleitet.
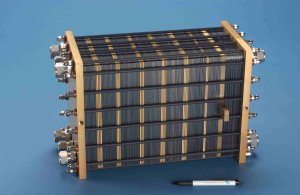
Ein Brennstoffzellen-Stack.
Foto: Forschungszentrum Jülich
Die an der Anode entstandenen Elektronen werden von der Membran daran
gehindert, auf direktem Weg zur Kathode zu wandern und
fließen daher über den externen elektrischen Leiter
dorthin. So entsteht ein elektrischer Stromfluss. In der
Kathodenschicht angekommen, verbinden sich die Elektronen mit
Sauerstoffmolekülen. Mit diesen Sauerstoff-Ionen reagieren die
an der Anode entstandenen Wasserstoff-Ionen (H+) zu Wasser, nachdem sie
die für sie durchlässige Membran in Richtung Kathode
passiert haben.
In der praktischen Anwendung werden je nach erforderlicher Leistung
mehrere Brennstoffzellen zu sogenannten Stacks in Reihe geschaltet.
Anders als bei fossilen Energieträgern drohen keine
Abhängigkeiten von Rohstoffländern, die im Falle des
Erdöls häufig in politisch brisanten Regionen liegen.
Brennstoffzellen haben einen hohen Wirkungsgrad, sie sind leise und im
Vergleich zu anderen Antrieben wartungsarm.
Wie funktioniert eine Brennstoffzelle?
In der Brennstoffzelle findet die Umkehrung der Elektrolyse statt, bei
der Wasser unter Zuführung von Energie in Wasserstoff und
Sauerstoff getrennt wird. Die Brennstoffzelle wandelt also die beiden
Gase Wasserstoff und Sauerstoff in Wasser um und erzeugt aus der dabei
frei werdenden Energie elektrischen Strom.
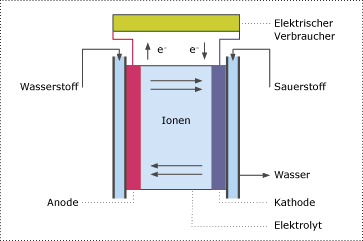
Schematischer Aufbau und Funktion einer Brennstoffzelle.
Quelle:Solaratlas Hochschule für Technik, Wirtschaft und
Kultur Leipzig
Aufgebaut ist die Brennstoffzelle aus drei Teilen: einer negativ
geladenen Schicht (Anode), einer positiv geladenen Schicht (Kathode)
und einem dazwischen liegenden Elektrolyten, häufig in Form
einer Membran. Anode und Kathode sind über einen elektrischen
Leiter miteinander verbunden. Der Wasserstoff wird an der Anode in die
Brennstoffzelle eingeleitet und spaltet sich dort in positiv geladene
Wasserstoff-Ionen (H+) und negativ geladene Elektronen auf. Parallel
dazu wird an der Kathode Sauerstoff eingeleitet.
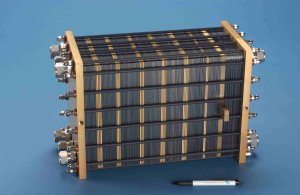
Ein Brennstoffzellen-Stack.
Foto: Forschungszentrum Jülich
Die an der Anode entstandenen Elektronen werden von der Membran daran
gehindert, auf direktem Weg zur Kathode zu wandern und
fließen daher über den externen elektrischen Leiter
dorthin. So entsteht ein elektrischer Stromfluss. In der
Kathodenschicht angekommen, verbinden sich die Elektronen mit
Sauerstoffmolekülen. Mit diesen Sauerstoff-Ionen reagieren die
an der Anode entstandenen Wasserstoff-Ionen (H+) zu Wasser, nachdem sie
die für sie durchlässige Membran in Richtung Kathode
passiert haben.
In der praktischen Anwendung werden je nach erforderlicher Leistung
mehrere Brennstoffzellen zu sogenannten Stacks in Reihe geschaltet.
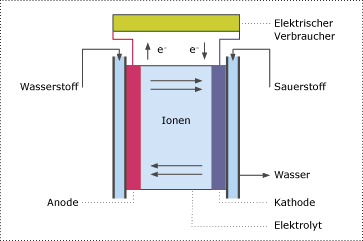
Schematischer Aufbau und Funktion einer Brennstoffzelle.
Quelle:Solaratlas Hochschule für Technik, Wirtschaft und
Kultur Leipzig
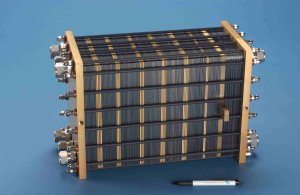
Ein Brennstoffzellen-Stack.
Foto: Forschungszentrum Jülich
Doch warum gibt es sie noch nicht?
Fragt man nun einen ausgewiesenen Experten wie Detlef
Stolten, warum die so vorteilhaften Brennstoffzellen so lange auf sich
warten lassen, räumt er zunächst mit
überzogenen Erwartungen aus der Vergangenheit auf. Neue
Technologien, so sein Argument, lösen oft eine große
Euphorie aus, in der eines übersehen wird: Sie stehen in
Konkurrenz mit etablierten Technologien, die einen enormen
Entwicklungsvorsprung haben. „Die hundert Jahre Vorsprung des
Verbrennungsmotors“, so Stolten, „lassen sich nicht
so einfach einholen.“

Wasserdampf statt schädlicher Abgase. Foto: Archiv
Stuttgarter Straßenbahnen
Dennoch hält er die von den Automobilherstellern genannten
Zeitachsen für einhaltbar. Nissan rechnet mit der Serienreife
in 20 Jahren, VW will bis 2020 ein „wirklich
wettbewerbsfähiges“ Auto mit Brennstoffzellenantrieb
auf den Markt bringen, so der für die Antriebsforschung
verantwortliche Wolfgang Steiger. Daimler-Chrysler nennt in seinem
Nachhaltigkeitsbericht 2006 das Ziel, gemeinsam mit anderen Herstellern
bis zum Jahr 2015 runde 100.000 Brennstoffzellenfahrzeuge verkauft zu
haben, und Honda will in Japan und den USA schon nächstes Jahr
damit beginnen, Wasserstoffautos an Privatkunden zu verleasen.
Zu Forschungs- und Erprobungszwecken sind bis dato etliche
Brennstoffzellenfahrzeuge in Betrieb. In zehn europäischen
Städten, darunter Stuttgart und Hamburg, wurden Omnibusse
getestet, und auch Privatpersonen können, wenn auch noch keine
Wasserstoff-Autos, so doch Brennstoffzellen zum Beispiel für
die Stromversorgung beim Campen kaufen. Außerhalb des
privaten Bereichs werden die Geräte heute schon als
zuverlässige Stromversorger von Messgeräten, Systemen
zur Verkehrsüberwachung und als Antrieb in U-Booten
geschätzt. Ein mobiles Exemplar mit einer Leistung von 25 Watt
ist für etwa 2000 Euro zu haben, für 65 Watt muss man
gut das Anderthalbfache berappen.


