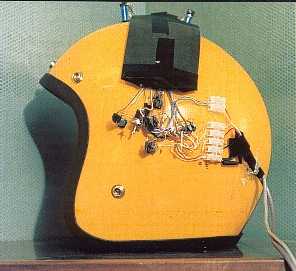Religion – Hirngespinst oder evolutionärer Vorteil?
von Lisa Peter
Religiosität als Forschungsgegenstand steht zurzeit hoch im Kurs. Geistes- und Naturwissenschaften nähern sich ihr von verschiedenen Seiten, sind in der Interpretation ihrer Ergebnisse aber aufeinander angewiesen. Neurologen, Psychologen, Religionswissenschaftler und Anthropologen versuchen zu klären, was bei religiösen Menschen im Gehirn vor sich geht und welche Vorteile es für Homo sapiens haben könnte, sich mit Transzendenz zu beschäftigen.
Die Naturwissenschaften entzaubern nach und nach die Welt um
uns herum. Die Hirnforschung scheint dem Menschen sein Selbstbild zu
rauben: Kulturell fest verankerte und auch politisch bedeutende
Konzepte wie der freie Wille und die damit verbundene
Handlungsautonomie des Menschen geraten zunehmend in Zweifel. Jetzt
geht es auch Gott und jeglicher Transzendenzvorstellung an den Kragen.
Könnte man zumindest meinen, wenn man die Diskussionen in der
sogenannten Neurotheologie der letzten Jahre verfolgt.
Der Mensch des 21. Jahrhunderts muss sich mit seiner radikalen
Sterblichkeit neu auseinandersetzen, findet Thomas Metzinger, Professor
für Philosophie an der Johannes Gutenberg-Universität
Mainz und Adjunct Fellow des Institute for Advanced Studies in Franfurt
am Main: „Neurowissenschaften und Evolutionstheorie machen
deutlicher als je zuvor, dass wir nicht nur sehr verletzliche, sondern
allem Anschein nach auch ganz und gar sterbliche Wesen mit einem ganz
und gar innerweltlichen Ursprung sind.“
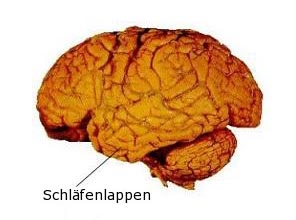
Die linke Gehirnhälfte mit dem
Schläfenlappen, der als Sitz religiöser
Gefühle gilt.
Graphik: Peter
Wo sitzt die Religion im Hirn?
Dennoch erfahren Religionsgemeinschaften einen starken
Zulauf, gerade unter jungen Menschen. Weshalb spielt Religion immer
noch eine so große Rolle, selbst 300 Jahre nach der
Aufklärung und im Zeitalter der Hirnforschung? Sind wir
genetisch vorprogrammiert, uns eine transzendente Instanz, gleich
welcher Ausprägung im Detail, zu denken? Welche Vorteile
könnte das haben?
In den letzen fünf Jahren sind eine ganze Reihe von Studien
veröffentlicht worden, die nach dem Sitz der
religiösen Empfindungen im Hirn fragen. Eine der
aufsehenerregendsten ist sicher die Versuchsreihe von Michael
Persinger. Der kanadische Neurowissenschaftler von der Laurentian
University in Ontario setzte seine Probanden mittels eines umgebauten
Motorradhelmes schwachen, aber konstanten magnetischen Feldern aus.
Diese im Fachjargon „transkranielle
Magnetstimulation“ genannte Technik regt den linken
Schläfenlappen an, eine Region, die bereits zuvor in Verdacht
geraten war, mit mystischen Wahrnehmungen in Verbindung zu stehen. Bei
der sogenannten Schläfenlappenepilepsie kommt es
nämlich in diesem Bereich des Hirns zu unkontrollierten,
gewitterartigen Energie-Entladungen. Laut Persinger berichten viele
Schläfenlappen-Epileptiker anschließend von
mystischen Erlebnissen während ihres Anfalls, von dem
Gefühl, einer fremden Macht begegnet zu sein, oder eine
Offenbarung eines göttlichen Wesens erfahren zu haben.
Auf der Grundlage weiterer Symptome wie akustischer Halluzinationen und
Lichtwahrnehmungen gehen einige Forscher so weit, die spirituellen
Erlebnisse Johannas von Orléans oder gar des Apostels Paulus
rückwirkend als epileptischen Anfall zu deuten. Persinger nahm
diese Erkenntnisse als Ausgangspunkt für seine Untersuchungen
und setzte sich zum Ziel, vergleichbare Erfahrungen bewusst und unter
Laborbedingungen herzustellen. Tatsächlich gaben rund 80
Prozent der Probanden an, nach der Stimulation mittels des
Motorradhelmes eine andere Präsenz neben ihnen im Raum
verspürt zu haben.
„Gottes-Helm“ und „Gottes-Modul“
Persingers Helm, der im angelsächsischen Raum sofort werbewirksam als „God helmet“ betitelt wurde, ist allerdings nicht unumstritten. Eine Forschergruppe der Uppsala University um Pehr Granqvist hat versucht, Persingers Versuchsablauf nachzustellen und dabei die Kontrollbedingungen zu verschärfen. In einer sogenannten Doppelblindstudie, in der weder die Versuchspersonen, noch die Mediziner wussten, wer zur Kontrollgruppe gehörte und wer wirklich den Magnetfeldern ausgesetzt wurde, konnten sie Persingers Ergebnisse nicht bestätigen.